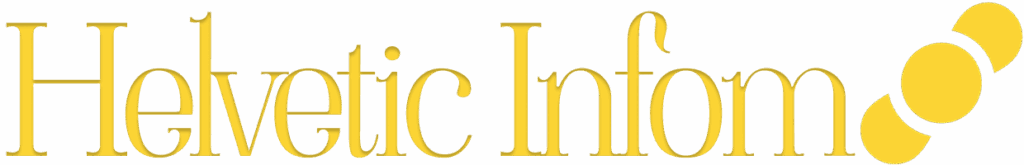Hochbegabung bedeutet nicht zwangsläufig ein Genie in Mathematik oder Musik. Sie kann sich auch durch tiefe Sensibilität, unkonventionelles Denken, eine lebhafte Fantasie oder frühe Reife äußern. In der Schweiz wird zunehmend anerkannt, dass diese Kinder eine individuelle Förderung anstelle eines beschleunigten Programms benötigen.
Werbung
Schweizer Schulen konzentrieren sich traditionell auf den durchschnittlichen Schüler. Daher langweilen sich hochbegabte Kinder manchmal, zeigen Verhaltensauffälligkeiten oder ziehen sich im Gegenteil zurück, um nicht aufzufallen. Der erste Schritt für Eltern ist, die besonderen Eigenschaften ihres Kindes zu erkennen und anzunehmen.
Eine Diagnose ist in spezialisierten Zentren möglich. Psychologen in Zürich, Bern, Genf und Lausanne führen Intelligenztests (wie den WISC-V) durch. Die Diagnose „Hochbegabung“ (IQ > 130) ermöglicht den Zugang zu Fördermaßnahmen.
Allerdings haben nicht alle hochbegabten Kinder einen hohen IQ. Manche Kinder entwickeln sich asynchron: Mit acht Jahren können sie Dostojewski lesen, aber noch nicht ihre Schnürsenkel binden. Es ist wichtig, das Gesamtbild zu betrachten.
Fördermöglichkeiten:
Vertiefung: Das Kind bleibt in der Klasse, erhält aber zusätzliche Aufgaben.
Förderung: Teilnahme an AGs, Wettbewerben und schulübergreifenden Projekten.
Akzeleration: Das Überspringen einer Klassenstufe ist selten, aber mit Zustimmung aller Beteiligten möglich.
Die Schweiz verfügt über ein starkes Netzwerk an außerschulischen Angeboten: Sommercamps für hochbegabte Kinder (z. B. von der Stiftung Begabtenförderung), AGs an Universitäten und Online-Kurse von SwissMOOC. Besonders gut ausgebaut sind die Angebote in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM), Musik und Philosophie.